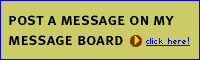Other papers
Fachsprachliche Übung für Germanisten
Das eigene Ich: Leben und Werke Maria Luise Kaschnitz
Kienlein
Sommersemester 1996
17. Juli 1996
The Seminar was on examples of German Short Story with Professor Kienlein
My Oral presentation from an outline garnered me a 1, but I believe this paper only received a 2.
„All meine Gedichte waren eigentlich nur ein Ausdruck des Heimwehs nach einer alten Unschuld oder der Sehnsucht nach einem aus dem Geist und der Liebe neu geordneten Dasein - in meinen Essays und Tagebüchern, ja auch in meinen Hörspielen, die ich durchaus nicht als unehrliche Kinder ansehe, überall habe ich nur versucht den Blick des Lesers auf das mir das Bedeutsame zu lenken, auf die wunderbaren Möglichkeiten und die tödlichen Gefahren des Menschen und auf die bestürzende Fülle der Welt.“ So widersprach sich Marie Luise Kaschnitz selbst während sie den Georg Büchner Preis für Literatur erhielt. Die Prosa und Lyrik der Marie Luise Kaschnitz, die als eine der bedeutensten Dichterinnen und Schriftstellerinnen der Nachkriegszeit galt, verköpern nicht nur das Dasein sondern auch das Bewußtsein einer ganzen Generation. Sie blieb immer eine Verkörperung des verlorenen Ichs und versuchte mit ihren Gedichten und Aufzeichnungen Fragen wie „der Sinn von sein“ an sich selber zu stellen. Diese inneren Blicke schafften für Kaschnitz die Möglichkeit des Überlebens. Kaschnitz versuchte weiter durch ihre Werke die Überlebenden und Opfer eines unbegreiflichen gewalttätigen Krieges zu schildern. Marie Luise Kaschnitz blieb ihr Leben lang kritisch, aber voller Hoffnung, und glaubte, daß eine gelungene Verszeile die Welt verändern könnten.
Geboren wurde Marie Luise Freiin von Holzing-Berstett 31. Januar 1901 in Karlsruhe, die unerwünschte Tochter eines hochwohlgeborenen Offiziers der preußischen Armee. Obwohl ihre Kindheit angenehm und wohlhabend gewesen war, litt die jüngste Tochter sehr an der Kühle ihrer Eltern. In der Aufzeichnung „Das Haus der Kindheit“, eine selbstironische Schilderung, berichtete die über Fünfzigjährige von der völligen Gleichgültigkeit ihrer Mutter als sie erfuhr, das es wieder kein Namensträger, wieder „kein Erbe der Stamm(e)sgüter, sondern nur ein Mädchen war.“
Das diese Gefühllosigkeit sie später so beeindrucken würde, zeigte sich hauptsächlich in der Darstellung der Menschen in ihren Werken. Sie waren eine Ausdruck für Kaschnitz eigenes Ich, eine Unsicherheit in Gestalt für ein Land, welches nur Fragen, Angst und Erinnerungen beinhaltete. In einem Gespräch mit Ekkert Rudolf erklärte sie, daß sie die Menschen zu Mitwissern machen will, um sie damit aufzuklären. Es gelang Kaschnitz ihre eigene Empfindsamkeit durch die Gestalten, die Figuren ihrer Geschichten herauszuarbeiten. Tatsächlich sind die meisten ihrer Werke autobiographisch; die Gedichte, Erzählungen und ihre Romane sind klassisch geschrieben und sie beziehen sich auf klassische Themen und auf das alltägliche Elend eines verlorenen , ausgestoßenen ,Ichs’.
Mit einem Jahr ist die kleine Marie Luise von Holzing-Berstett, ein kleines unauffälliges Kind, das mit ihren Eltern und ihren zwei älteren Schwestern nach Potsdam zieht. Nachdem der einzige Sohn, Peter, das vierte Kind der Holzing-Berstett geboren wurde, wurde die Distanz zwischen den Eltern und der dritten Tochter vergrößert. Die älteste Tochter Karola, genannt Mady, wurde zur Lieblingskind des unnahbaren Vaters, die zweite Tochter, Helene, genannt Lonja, als ,schönste’ der drei Schwestern sei in Musik, Sprachen und im Schreiben begabt. Natürlich war es eine beschwerte Kindheit für Marie Luise gewesen, durchlebt von einem „sensiblen, ängstlichen und schüchternen Kind die diese Unsicherheit, diese Kinderängste entweder genau beschreibt oder immer in ihren Geschichten verschlüsselt. Diese Kurzgeschichten entstanden aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg als sie ein Verlangen nach einem neuen Anfang des Deutsche Volkes spürte: „Mit einmal wußte ich, auch die deutschen Leser und Hörer sind weder ruhig, noch zufrieden, noch satt-- sie haben nur einen anderen Hunger, eine andere Unruhe und eine andere Furcht....“ Mit ihrer Literatur hat Kaschnitz immer wieder versucht diese Furcht auszulöschen, in ihr selbst und ihren Lesern.
Von Anfang an war sie ein phantasievolles Kind gewesen. Kaschnitz wuchs in privilegierter Umgebungen, in Potsdam und Berlin, auf. Sie litt aber unter der Unaufmerksamkeit ihrer Eltern, die sich um ihre begabten Schwestern und ihren Bruder kümmerten, und fühlte sich immer wieder verlassen oder überflüssig. Ihre Mutter interessierte sich für die Gesellschaft, andere Menschen und ihre Ansprüche, von den Kindern wollte sie wenig wissen. Sie verzichtete viel auf die täglichen Bedürfnisse der Familie aber stand darauf viel für das Außergewöhnliche auszugeben. „Sie lud zu Konzerten in ihr Haus ein, es wurden klassische Trios gespielt, denen die Tochter hingerissen lauschte.“ Kaschnitzs Vater distanzierte sich von den Kindern und der Mutter in dem er, nach seiner Entlassung vom Dienst, ins Garten schlaf. Für ihn sei es daß die Familie so wenig und die Männerwelt des Krieges so viel bedeute.
In „das dicke Kind“, eine Kurzgeschichte die von dem Standpunkt einer älteren Bibliothekarin geschrieben wurde, sind die Perspektive mehr autobiographisch als fiktiv. In ihren Aufzeichnungen „Orte“ teilte Kaschnitz mit, „das dicke Kind bin ich selbst. Die Schwester ist meine Schwester Lonja, der See ist der Jungfersee bei Potsdam...Ich war ein braves, schläfriges und viel essendes Kind aber eben eines mit vielen Ängsten und eines, das bei jeder Gelegenheit zu heulen anfing.“ Umgeben von Gouvernanten und Kindermädchen, lernte sie den Unterschied zwischen Reichtum und Armut kennen. Als eine Spielgefährtin von der einzigen Tochter
Kaiser Wilhelm II, verachtete die junge Kaschnitz diesen Unterschied und wendete sich ihre Liebe auf die Natur, Phantasie und Tierwelt hin. „Sie erlebte die Welt durch die verwandelnde Kraft ihre Phantasie, eine selbstschaffene Welt mit übersinnlichen Elementen ausgestattet.“
Die täglichen Erlebnisse und ihre Schulzeit am Konservatorium drückten sich in vielen ihre Geschichten aus. Trotzdem fiel es ihr schwer, diese Stadt zu lieben. Dort bekam sie 1930 ihr erstes Literarisches Lob, nämlich für die zwei Erzählungen „Spätes Urteil“ und „Dämmerung“, die in einer Anthologie Unbekannter Autoren gedruckt wurden. „Spätes Urteil“ händelt von einem Trauma und den Schuldgefühle eines jungen Bauern, der ein Unglück verursachte an dessen Folge seine Geliebte umkam. „Im „Späten Urteil“ ist eine technikfeindliche und antimoderne Tendenz in der Darstellung der Maschine zu erkennen...sie ist ein unübersehbares Indiz für die Infragestellung moderner Werte im Ausgang der Republik.“ Schon früh fängt Kaschnitz mit einem idealisierten Optimismus an, sie zeigt sich als Mitläuferin der frühen NSDAP, in dem sie das Leitbild eines bäuerlichen Lebens nachahmte und über Optimismus und das Ideal schreibt. Ihre Werke zwischen 1933-45, die zum größten Teil während der Kriegeszeit veröffentliche wurden, wies auf einen „Rückgriff der Novellenform im Zusammenhang mit der Erneuerung ältere Formen und Tradition um dieser Vorkriegszeit.“
Um das Vergessen zu verhindern, hielt es Kaschnitz für wichtig, in ihren Werken, die Grenzen zwischen der Kindheit, dem Heranwachsenwerden und dem Erwachsensein deutlich darzustellen. Perspektiven ihrer Kurzgeschichten erzählen immer von einer Ausgestoßenen. Dieses ausgeschlossene, eingekreiste „Ich“ forderte das wir die Nachkriegszeit im Nachhinein besser verstehen können. Das „Ich“ wirkt Geheim und zweideutig. Es ist gleichzeitig eine künstlerische Fiktion und eine bekenntnishafte Autorität. Wir können leicht das Ich Kaschnitzs Werke von der Autorin selbst auseinanderhalten, aber wäre das sinnvoll ? Weil sie stark von ihrer Umgebung und dem Geschehen des zweiten Weltkriegs entsetzt war, fühlte sie sich weder als ein Teil der jungen Generation der Nachkriegszeit noch als eine Schriftstellerin von der verstummten Schriftsteller-Mehrheit. Ihre Kurzgeschichten und Gedichte enstanden als eine Art Selbstprüfung oder Selbstrechtfertigung, die das deutsche Volk nicht fähig war an sich selbst zu stellen.
Nachdem Kaschnitz eine Lehre als Buchhändlerin in Weimar gemacht hatte, zog sie nach München wo sie ihren zukünftigen Mann erstemals begegnete. Die junge Marie Luise von Holzing-Berstett zog später nach Rom um Guido Freiherr von Kaschnitz-Weinberg wieder zu treffen. 1925 schlossen sich die Buchhändlerin und der Archäologe die Ehe und lebten in Rom ein. Ihr Mann wurde zum Förder ihrer schriftstellerischen Arbeit und wenn sie gefragt wurde , warum sie unter dem Ehenamen Kaschnitz schrieb, sagte sie daß es ihr Mann war, der sie zum Schreiben ermutigt hatte und ihr bester Kritiker gewesen war.
Ende der zwanziger Jahre entstand in Rom ihr erste Roman „Liebe beginnt“. „Dieser Roman handelt vor der Haßliebe in einer mythischen Abstraktheit: das gebärende, tierhafte Weib paßt nicht in den bürgerlichen Kulturbegriff -- die Liebe, die als Schuldknoten durchs Leben wirkt, versuchte sie aufzulösen und wie die Heldin ihres Buches, Silvia, zog Kaschnitz die größte dichterische Kraft aus dem Tod ihres Mannes.“ So fängt Marie Luise Kaschnitz an. Ihre Werke verkörpern ihren Glauben, aus der Geschichte und Vergangenheit, eine neue Weltordnung schaffen zu können-- eine von Frieden, die später in der Nachkriegszeit in ihren
Gedichten, wie z.B. in „Hernach“ , wie ein „Anachronismus gegenüber die Realität“ , wirken würde:
Einst wird sein, daß dieses wilde
Wetter auch zu Ende geht,
Daß ein Abend voller Milde
Über diesen Tälern steht.
An Weihnachten 1928 kam Iris Constanza, das einzige Kind der Kaschnitz, zur Welt. Einige Wochen vor der Geburt des Kindes, flüchtete die junge Kaschnitz aus Rom um ihren Mann von ihrem „kreatürlich plumpen“ Wesen zu schützen. Ihre weibliche Schönheit, ja dies zu behalten, bedeutete ihr sehr viel. So viel daß von „Schönheit ist damals in ihren Gedichten oft die Rede, Schönheit, ein Wert der die Frau begehrenswert macht, ja geradezu ihren Lebenssinn bedeutet.“ Darauf wies die Biographin Dagmar von Gersdorff hin, daß Kaschnitz mit der Geburt ihrer Tochter zufällig wie ihre Mutter wirkte; abwesend, schroff und ablehend. In „Orte“ beschreibt Kaschnitz die Geburt ihres Kindes mit distanzierenden und analysierenden Details: „Als ich erst zur Besinnung komme...es ist erst drei Uhr früh, um zwei Uhr ist mein Kind zur Welt gekommen, ich war nicht dabei...Es ist kein Kind da, das Kind ist tot...“ Die spätere Gedichte, die an die kleine Tochter gewidmet wurden, zeigen die Schuldgefühle wegen dieser Aufregung der Tochter gegenüber. Kaschnitz spricht oft von „Ein-Herz-eine-Seele-sein,“ eine neologistisches Wort, das durch Kaschnitzs Phantasie die ewige und einzige Liebe zur ihrem Mann darstellt.
Dieser ,Absolutheitsanspruch’ ist in ihrem ersten Roman gespiegelt. Ihre Art immer autobiographisch zu schreiben ist einer Art Selbstbestätigung. Kaschnitz fühlt sich zu ihrem Mann hinhingezogen aber Teils auch untertänlich und verliert dadurch ihr eigenes Bewußtsein. Wie in „Große Wanderung“ beschreibt sie, „Verlorene. Aber an wen ?/ An wen Verloren?“. Wir sind darauf merksam gemacht, wie traditionell Kaschnitz sich zur Männer verhalten ließ. Als ihr die Stelle als Mitherausgegeberin bei der „Wandlung“ angeboten wurde, schrieb sie ihrem Freund und Mitarbeiter Dolf Sternberger: „bitte überleg Dir das noch einmal ! Denke daran wie dumm, wie schüchtern und wortkarg ich in Gesellschaft wirklich gebildeter Männer bin...daß ich nicht nur in Positiven, sondern auch in Negativen eine Frau bin.“ Trotz ihrer Mitarbeit mit PEN und der „Wandlung“ fühlte sich Kaschnitz von einer großen Schüchternheit überwältitgt. Es blieb für sie nur die Möglichkeit ihre Wünsche durch ihre Werke zu erleben. Jedes Werk ist eine Periphase ihres ,Ichs’. Als sie später ein Referat über „Das Weibliche in der Kunst“ hielt, fragte sie ob das Weibliche als Begrenzung oder Möglichkeit betrachtet werden sollte. Ihre Antworte lautete: „Dem Mann gelingt das Weiblichste, der Frau nicht das Männlichste“
Der Tod ihres Vaters 1932 und die grausame Weiterentwicklung der NSDAP warf die junge Kaschnitz in Verwirrung und Schock. „Mit dem plötzlichen Bewußtsein, blind ins Gefängnis gelaufen zu sein, änderte sich in Zukunft ihr Lebensgefühl.“ Wie sie in „Das Haus der Kindheit“ später berichtete, fühlte sie sich „herausgefallen aus der Unschuld.“ Für sie wird alles zerstört. Diese Glaube, oder besser gesagt, diese Verzweiflung an dem humanen Zustand der Menschheit während der Frühkriegeszeit, förderte von Kaschnitz eine neue Stimme in ihren Werken. Gleichzeitig sanft und beurteilend wirkte sie viel kritischer ihren Zeitgenossen gegenüber als je zuvor. In seiner Essay „das verlorene Ich“ schreibt Ralf Schnell weiter, „Hatte Kaschnitz in ihrer Vorkriegslyrik durch Formentraditionalismus Zeitlosigkeit des Krieges durch die Formstrenge des Sonnetts sublimiert, so erscheint nach 1945 die Aufsprengung der geschlossenen Form als Dominante ihres Werks“ Trotz der Grausamkeit der Nachkriegzeit zeigte Kaschnitz ihren Optimismus immer in der Hauptform der Ära. Insofern gehört sie doch zu der jungen Generation; aber es war nur in der Nachkriegszeit daß sie sich traute, die Chaos und Verwirrung dieses Generation zu beschreiben.
Während der Kriegzeit wohnten die junge Ehepaar zuerst im Marburg wo Guido Kaschnitz-Weinberg einen Ruf an der Universität enthielt. Nach 1941 zogen sie nach Frankfurt am Main um weiter an den Universität dort zu arbeiten. Unterdessen Lebensumstände, schrieb Marie Luise Kaschnitz weitere Gedichte die regelmäßig in Athologien und in der Frankfurter Zeitung erschienen. Ihre Literatur zeigte sich ab 1933 als kein großer Damoklessschwert für die
Nationalsozialisten, allerdings während jüdische Verlage wie Peter Suhrkamp „unerwünschte Literatur“ veröffentlichten, wurden sie bis Kristallnacht 1938 nicht weiterhin betroffen. In einer 1989 veröffentlichte Dissertation hieß es: „Offenbar sind die Grundlagen der publizistischen Nachkriegsaktivitäten der Autorin eng mit ihren Kontakten zum Kreis der alten Frankfurter Zeitung verbunden, an die sie nach 1945 unmittelbar anknüpfen konnte.“
So vorsicht die Sonnette Kaschnitzs der Kriegeszeit waren, so wirkten manchen ihren Prosa und Lyrik im Nachkriegszeit bedenklich und teils kristisch der neue Adenauer-ära gegenüber. Obwohl keine deutliche Unterbrechen ihre Arbeit zuerkennen ist, bekam Kaschnitz die Möglichkeit die Werke, die von 1944-45 wegen ihre Flucht aus Frankfurt zu Seite gelegt wurden, weiter zu bearbeiten. Während diesen Jahren, die sie im Taunus verbracht hatte, schrieb Kaschnitz weiter mit ehemaligen Bekannten von der F.Z. an den literarischen Zeitschriften Die Wandlung und Die Gegenwart. In der ersten Aufgabe der Wandlung strand ein Essay, dessen Thomas Mann als der „beste Eindeutigste, moralisch Mutigste das ihm aus dem neuen Deutschland bisher vor Augen gekommen sei“, lobte. Ihr Essay, „Von der Schuld“ spricht nicht von der Perspektiv einer Nullpunkt oder Kahlschlag Schriftstellerin, Kaschnitz selbst emphand nichts für diese Gattungsgrenzen, sondern begann mit einer einfachen Frage . „Und was tatest Du ? ...was wir jetzt erfahren ist nur ein Lautwerden der Stimme die uns lange quälten und die erst unter den furchtbaren Sühnesschlängen des Schicksals wieder zum Schweigen kamen. Und die Fehlbarkeit der Urteilssprecher darf uns nicht hinwegtäuschen über die Nötwendigkeit einer Besinnung, die wir selber vollziehen.“
Nachdem Kaschnitz zurück nach Frankfurt gezogen war, fand sie ein neuer Form des Schreibens welches sie vorher wenig benutzt hat--nämlich die Kurzgeschichte. Mit ihrer Anthologie Das dicke Kind und andere Erzählungen werden ihre Geschichte zur „Auffassung von der Veranwortung eines Schriftstellers.“ Man sieht das sie ihren Objektiv vollkommen geändert hat. Kaschnitz versucht nicht mehr die Optimismus einer Zeit zu schildern, wird aber mehr und mehr zur Beobachter. In Rückkehr nach Frankfurt, Hiroshima, oder die spätere Kürzgeschichte , Popp und Mingel , beschrieb Kaschnitz die wahre Nachkriegszeit. Das Kind im Popp und Mingel wird zur einer Darstellung wie das Leben sich geändert hat. An dem Kind wurde alles angeboten: Kalbsleberwurst, Äpfeln und Taschengeld, um es allein lassen zukönnen. So wird es zu einer Representation Deutschland in der Nachkriegszeit. Der Junge hält sich an das Alte; eine verschrümpfte Luftballon, ein Füßball, eine Puppe ohne Beine namens Mingel und ein Schachfigur. Er trennt sich mehrmals von der Realität und dadurch trennt sich selbst von seinen Eltern. Er verliert den Verstand wenn das was er anerkannt, nämlich seine Spielzeuge, weg sind. Er ist die Verkörperung seines Landes und der Produkt Kaschnitz. Nun jetzt zeigt uns Kaschnitz wie es war und nicht, wie ihren vorherigen Art, wie es sein soll .
Anfang 1952 wurde Das dicke Kind und andere Erzählungen veröffentlicht. Es war hauptsächlich durch diesen Geschichten daß Kaschnitz berühmt wurde. Für Kaschnitz bedeutete dieser Aufmerksamkeit einer Belohnung jahrelang Arbeit. Doch dieser herrlicher Zeit war begrenzt. Kurz nach einer PEN Tagung in London erkrankte ihren Mann 1956 an einen bösartiger Tumor. Marie Luise Kaschnitz fühlte, trotz gezeigte Optimismus Verwandte und Freunde gegenüber, hoffnungslos. Die Wirklichkeit daß ihren Mann vor ihren Augen langsam und quälend sterben muß, schien ihr als „der eigentliche Höllensturz“:
Mit Asche bedeckten sie da
Das Feuer deines Herzens,
Zusehen mußte ich, wie es erloch
Funke um Funke.
Zur selben Zeit erschien ihre Aufzeichnungen Das Haus Der Kindheit in den das Niederschreibens Kindheiterinnerungen als Selbstfindung und Rechtfertigung servierte.
1958 starb Guido von Kaschnitz, zwei Jahre nachdem er erkränkt wurde. Luise Rinser berichtete daß Marie Luise Kaschnitzs Verzweiflung zur dieser Zeit Unvergeßlich blieb. Man sieht Kaschnitzs Verzweiflung in den 1958 veröffentlichte Dein Schweigen--Meine Stimme:
Dein Schweigen
Meine Stimme
Dein Ruhe
Mein Gehen
Dein Allesvorüber
Mein Immernochda.
Kaschnitz sprach in Orte weiter von ihrem Leben mit Guido: „Alles war wichtig...alle Tage. Als hätte uns auch Friedenzeiten eine schreckliche Gefahr gedroht, Gefahr des Sichverlierens.“ Nach Guidos Tod, fühlte sie sich gleichzeitig trauig und einsam, zwischen „Todessehnsucht und Lebenswillen“ Sie arbeitete daran , seiner Werke, Schriften und Vorträge zu veröffentlichen. Trotz diesen Beschäftigungen schrebt sie selber weiter, erst an die Erzählung Am Cicero. Wie die Biographin Gersdorff beschreibt, „es ist ein Ort als Liebes- und Todessymbol: „Am Strand entlang, immer angeschaut nach einem Körper,...den sollte das Meer ans Land spülen, der Tod aus Land spülen, denn das Meer ist auch der Tod.““
So taucht sie in die Erzählung Eines Mittags, Mitte Juni selbst auf. Die Frau Kaschnitz in dieser Geschichte will sich beim Schwimmen ertrinken lassen, doch überlegt sie sich: „das Leben ist nicht sinnlos, ich bin nicht allein auf der Welt.“
1960 erschien Lange Schatten in dem die Erzählungen Popp und Mingel, Am Cicero und
Eines Mittags, Mitte Juni stehen. „Immer sind es gerade jene Menschen (in diesen
Geschichten), die sich besonderes innig lieben...die sich am heftigsten in anderen irren.“
Diese Täuschung ist besonders in „Popp und Mingel“ zu erkennen. Vielen von den Erzählungen sind Beispiele für „einen Bruch auf dem Weg zum Erwachsenwerden.“ Der Junge aber in „Popp und Mingel“ nimmt ein erwachsene Verantwortung auf sich und seins ist die Geschichte einer auf dem Weg zum Kinderwerden. „Popp und Mingel“ bleibt in die Kurzgeschichtegattung. Zeit Raum und Perspektiv sind passend. Kaschnitz steht in diese Geschichte wie in ihre erste Kurzgeschichte „Spates Urteil“ die Technik feindlich gegenüber. Die Vernachläßigung der Eltern verraten das Kind. Er sehnt sich nach einer Familie und sucht von seinen Spielzeugen eine aus. Der innere Monolog bildet sich durch einen anspruchvoller Redeart ein erwachsene Kind vor. Doch is der Junge detso tragischer. Er ist verloren und paßt sich am Ende zu anderen Kindern zu.
Marie Luise Kaschnitz fühlte sich nie „die große alte Dame der Literatur, wie sie von ihren Zeitgenossen genannt wurde. Die letzte zehn jahren ihres Lebens verbrachte sie zwischen Frankfurt und Rom. Es war September 1974 daß sie von Schwimmen sich an einer Lungenentzündung erkränkte und nach Rom ins Krankenhaus gebracht werden mußte. Sie starb zehn Tage später am 10 Oktober 1974. In Wohin denn Ich ? schrieb Kaschnitz die Antwort ihrer eigenen, selbstgestellten Frage. Für uns muß diese Antwort als Erklärung ihres Ichs genügend: „Eines Tages bin ich zurückgekommen, zurück woher, davon werde ich später sprechen, jetzt nur soviel sagen, daß ich fort war, lange und weit fort. Wenn sie wissen wollen wer hier spricht, welches Ich, so ist es das meine und auch wieder nicht, aus wem spräche immer nur das eigene Ich.
Quellen
Lambert Schneider. Die Büchner Preis: Die Reden der Preisträger 1950-62. Heidelberg/Darmstadt, 1963.
Christian Buttrich und Norbert Miller. Gesammelte werke von Marie Luise Kaschnitz. Band 3. Frankfurt am Main, 1983.
Dagmar von Gersdorff. Marie Luise Kaschnitz: eine Biographie von Dagmar von Gersdorff. Frankfurt am Main, 1992.
Ekkert Rudolf, Hrgr. Marie Luise Kaschnitz in : Protokoll zur Personen; Autoren über sich und ihre Werk. München, 1984.
Elsbeth Pulver. Marie Luise Kaschnitz. München, 1984.